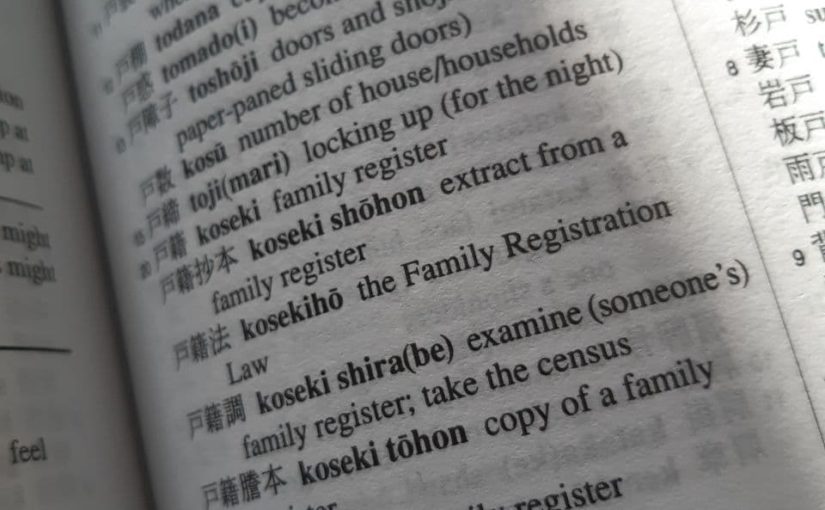Während meines Studiums bin ich immer wieder über ein bestimmtes Thema gestolpert, das ich damals leider nicht weiter vertiefen konnte. Bei diesem Thema, das sowohl Phänomen als auch Problem der japanischen Gesellschaft ist, handelt es sich um das sogenannte JK business. Diesem Blogartikel gehen keine umfassenden wissenschaftlichen Recherchen voraus, dennoch möchte ich erste Aspekte nennen, die mir bei diesem Thema zu denken geben. Wenn jemand sich mit JK business gut auskennt, insbesondere auch mit dem rechtlichen Hintergrund, dazu geforscht hat o. ä. wäre ich sehr dankbar für weitere Infos, konstruktive Kritik und Hinweise.
JK für das japanische Wort für Schülerin einer Oberschule (joshi kokosei) und business ist im Sinne von Geschäft / Geschäfte zu verstehen. Genau genommen ist JK business eine Unterkategorie von enjokosai. Enjokosai bedeutet soviel wie „vergütete Dates“ und hat auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit dem, was Escortservice oder Hostess mit einschließt. Bei enjokosai bietet normalerweise eine Frau ihre Dienste und ihre Zeit einem Mann an. Diese Dates können alles von einfachen Unterhaltungen, Massagen, Restaurantbesuchen bis hin zu Sex beinhalten. Es wird vermutet, dass enjokosai und ähnliches sich in Japan in vielen Varianten entwickelt hat, da offene Prostitution gesetzlich seit 1958 verboten ist. Es wäre einfach, enjokosai und das ganze JK business abzuhaken als eine der vielen seltsamen und komischen Dinge, die die japanische Gesellschaft an „Unterhaltung und Amüsement“ zu bieten hat. (Wieso sollte ein Mann eine fremde Frau dafür anheuern, dass er ihr seine Sorgen und Nöte erzählen kann, während sie ihm die Ohren säubert?) Aber so seltsam manches scheinen mag, solange gegenseitige Zustimmung und Regeln beachtet werden und keine Minderjährigen darin involviert sind, ist dagegen aus meiner Sicht nicht viel zu sagen.
Womit wir auch schon beim springenden Punkt sind. Denn beim JK business handelt es sich naturgemäß um Dienste, die von Schülerinnen angeboten werden, die oft noch nicht 18 Jahre alt sind. Kunden dieser Mädchen sind meist Männer mittleren Alters, denen die Mädchen verschiedene Services anbieten. Offiziell beinhaltet das Angebot unschuldig anmutende Dinge wie Restaurantbesuche, Besuche in Karaokebars, Spaziergänge, Unterhaltungen oder Wahrsagen. Viele Kunden bezahlen die Mädchen nicht nur, sondern schenken ihnen außerdem Markenkleidung oder Accessoires.
Es besteht dabei eine große Gefahr für die Mädchen von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt zu werden, in gefährliche Situationen zu geraten oder Opfer von Missbrauch zu werden. Sowohl Mädchen und junge Frauen aus dem Bereich als auch Aktivisten gegen Kindesmissbrauch und Menschenhandeln berichten, dass hinter dem JK business undurchsichtige Organisationsstrukturen stecken und eventuell auch die Yakuza, also die japanische Mafia, ein Interesse an diesen Geschäften hat.
Es ist sehr einfach für Mädchen, an diese Jobs zu geraten. Sie können sich zum Beispiel im Internet auf der Seite eines Shops registrieren. Werden sie genommen, macht der Shop für die Mädchen Dates mit den Kunden aus. Außerdem stehen die Mädchen oft auf belebten Straßen der Großstädte mit ihren Fotos und Flyern, die sie an potentielle Kunden verteilen. Es ist also nicht überraschend, wenn man durch Ikebukuro oder Akihabara läuft und von Mädchen in Schuluniformen angesprochen wird, die Massagen oder Handlesen anbieten.
Da diese Dienste nicht direkt gegen das Anti-Prostitutionsgesetz oder den Jugendschutz verstoßen, haben Polizei und Sozialarbeiter keine rechte Handhabe. Einige japanische Präfekturen versuchen dagegen vorzugehen, indem sie JK business durch unter 18jährige komplett verbieten. Auch sind in dem Medien von Zeit zu Zeit Razzien zu sehen, wo die Polizei einige JK business Shops durchsucht und schließt. Doch bis jetzt scheint es kein probates Mittel zu geben, um diese Geschäfte vollständig unter Kontrolle zu bekommen.
Ein Problem, dass mit JK business zusammenhängt, ist meiner Vermutung nach, dass die Gesellschaft sich zu sehr auf das Verhalten und Benehmen der Mädchen und jungen Frauen konzentriert, statt sich zu fragen, warum es toleriert wird, dass Männer in dieser Art und Weise ihrem Interesse an jungen und minderjährigen Mädchen weiter nachgehen. Es wäre wohl sehr blauäugig zu glauben, dass alle diese Männer sich nur ein wenig unterhalten möchten.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich die ganze Art und Weise, wie die japanische Gesellschaft das Interesse von Männern an Schulmädchen fördert, problematisch finde. Man braucht nur kurz an die omnipräsenten Popbands zu denken, die aus Schulmädchen zusammengecastet sind. Zielgruppe sind gestresste männliche Angestellte, deren Fantasien befeuert werden durch suggestive Songs mit Titeln wie „Meine Schuluniform ist mir im Weg“ oder „Liebe einer Jungfrau“, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Absicht und Motivation der Kunden bzw. Fans mögen sehr unterschiedlich sein. Mir scheint es jedoch so, dass sowohl JK business als auch die Popbands den Männern das Gefühl geben, als wohlwollende Gönner und Beschützer tätig zu werden, wodurch herkömmliche Rollenbilder bestätigt werden. Das ist ein Gegensatz zur Realität, in der auch in Japan Frauen immer unabhängiger werden und in Bereiche des Lebens vordringen, die zuvor nur von Männern besetzt worden sind. Frauen machen Karriere, stehen für sich selbst ein und zeigen mehr Selbstbewusstsein. Dies mag für einige Männer bedrohlich wirken. Für solche Männer können die Mädchen als Bestätigung althergebrachter Rollenvorstellungen fungieren.
Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass einigen Kunden auch einfach nur der zwischenmenschliche Kontakt fehlt, ohne dass sie dabei sexuelle Absichten im Hinterkopf haben. Aber, um es klar zu sagen, andere „Kunden“ versuchen wiederum, ihre sexuellen Fantasien auszuleben; wieder andere glauben so, Macht über Mädchen und Frauen ausüben zu können, denn sie haben ja dafür gezahlt.
Was könnten die Gründe für die Mädchen sein, im JK business zu arbeiten? Zunächst ist so ein Job eine gute Möglichkeit, schnell relativ viel Geld zu verdienen. Oft erhalten die Mädchen doppelt soviel Geld, wie ihre Freunde mit anderen Jobs. Dazu gibt es bei manchen Kunden noch extra Geschenke und Aufmerksamkeiten, was natürlich verführerisch ist.
Natürlich mag auch die naive Neugierde von jungen Menschen eine Rolle spielen und die Mädchen dazu bringen, es einfach mal auszuprobieren. Dadurch können sie sich auch mit den anderen vergleichen und herausfinden, was sie selbst so „wert“ sind.
Außerdem kann die Arbeit im JK business als ein Akt der Rebellion gegen Eltern, Familie, Schule und der Gesellschaft als Ganzem angesehen werden. Mädchen können es als ein Mittel verstehen, dadurch trotzig ihre Antihaltung gegen Moralvorschriften zum Ausdruck zu bringen.
Dann gibt es noch die Mädchen, die einen schwierigen persönlichen Hintergrund haben. Deren Familie zerrüttet ist, und die nicht wissen, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen können. Solche Mädchen sind leichte Opfer. Mit ein bisschen Aufmerksamkeit fühlen sie sich wertgeschätzt, gewollt und gebraucht.
Des Weiteren spielen Armut und frühere Gewalterfahrungen eine Rolle. Auch in Japan gibt es Kinder und Jugendliche, die durch das soziale Auffangnetz fallen und sich aus purer Not von Fremden zum Essen einladen lassen und im Gegenzug mit ihrem Körper bezahlen. Einige Mädchen berichten, dass sie in der Vergangenheit auch negative Erfahrungen mit Sozialarbeitern oder staatlichen Fürsorgeeinrichtungen gemacht haben und möglichst nichts mehr mit denen zu tun haben möchten.
In der gegenwärtigen Rechtslage haben Sozialarbeiter und Polizei bis jetzt wenig Handhabe und Mittel, gegen organisierte zwielichtige Geschäfte vorzugehen. Gleichzeitig hat sich auch privates Engagement dem Problem angenommen. Ein Beispiel ist COLABO, eine Organisation, die von Frau Yumeno Nito gegründet wurde. Als Jugendliche ist sie selbst von zu Hause davongelaufen und teilt die Erfahrung des Verlorenseins und der Verzweiflung mancher Mädchen und jungen Frauen. Einige von Nitos Freunden arbeiteten ebenfalls im JK business, einige wurden verletzt oder ausgebeutet und andere begingen schließlich Selbstmord.
Nito versucht nun, jungen Frauen und Mädchen in ähnlich schwierigen Lagen zu helfen. Beispielsweise geht sie nachts hinaus auf die Straßen von Tokyo und spricht Mädchen an, die Probleme zu haben scheinen. Sie bietet ihnen ein warmes Essen und einen Platz zum Ausruhen. Indem sie sich um sie kümmert, ihnen zuhört und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, hofft Nito, dass die Mädchen nach und nach Vertrauen fassen, über ihre Probleme reden und sich von ihr und anderen helfen lassen. Sie möchte, dass die Mädchen einen Weg herausfinden aus diesen “Jobs”, aus Druck und Scham. Nicht selten geben die Mädchen sich selbst die Schuld und die Verantwortung dafür, wenn ihnen etwas schlimmes widerfahren ist. Nito betont deshalb umso vehementer, dass die Gesellschaft aufhören muss, die Mädchen als die Verantwortlichen zu sehen, und stattdessen nach den Personen fragen sollte, die hinter den Szenen die Strippen ziehen, und nach den Männern, die die Lage der Mädchen ausnutzen. Es muss begriffen werden, dass die Mädchen dies nicht aus Spaß oder aus hedonistischen Gründen tun, sondern oft eine ganze Reihe unglücklicher Faktoren eine Rolle spielen. Die Frage nach der Verantwortung der Gesellschaft, der Leute, die die Mädchen anbieten und der Kunden, sollte gestellt werden.
Es gibt Stimmen innerhalb und außerhalb von Japan, die behaupten, Leute ohne Ahnung würden sich hier künstlich aufregen. Ihrer Meinung nach ist das ganze JK business eine kulturelle Erscheinung in Japan, die auch als solche akzeptiert werden sollte. Aber ist ein derartiges Phänomen, das es erlaubt und erleichtert, Minderjährige auszubeuten, wert verteidigt und geschützt zu werden? Doch wohl nicht. Außerdem hat Japan als Industrienation und Demokratie diverse Vereinbarungen und Standards zum Schutz der Menschenrechte und des Jugendschutzes unterzeichnet.
Es gibt noch ein weiteres Argument, das das JK business von einem feministischen Standpunkt aus verteidigt. Demnach sind JK business und enjokosai Wege, die patriarchalen Strukturen, mit denen Männer Frauen besitzen und Macht über sie ausüben, zu untergraben. Denn solchen Arbeiten nachzugehen, verstößt gegen alle Normen, nach denen sich ein Mädchen oder eine Frau in Japan zu verhalten hat. Somit wird JK business zu einem Weg, die Bestimmungsgewalt über sich und seinen Körper zurückzugewinnen. Die Mädchen bestimmen nun selber über ihren Körper und entscheiden, an wen sie sich wie verkaufen. Ähnliche Argumente hört man auch in der hiesigen Debatte über Prostitution an sich. Doch ohne weiter darauf eingehen zu wollen, ist zu sagen, dass, solange hier Minderjährige im Spiel sind, ein solches Argument mir ganz und gar nich einleuchten will.
Es bleibt zu hoffen, dass die Gesellschaft durch Engagement wie das von COLLABO beginnt, Dinge zu hinterfragen und vor allem aufhört, die Mädchen pauschal für ihr “schlechtes Benehmen” und “böses Treiben” zu verurteilen. Im Gegenteil, es sollte überlegt werden, wie ihnen geholfen werden kann und wie Männer, die sich hier strafbar machen, effektiv verfolgt werden können.
Die englische Version dieses Beitrags findet sich unter Supply and Demand – Girls for Rent.
Quellen und Infos:
https://www.colabo-official.net/
https://www.youtube.com/watch?v=DNmJ_qv1XMo&lc=z12oh5i4bxqbvzxeu23ehf2pcv3hvphjy04